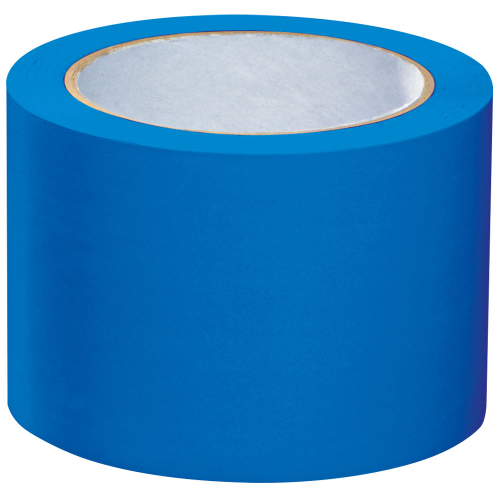Der Morgenkaffee schmeckt bitter. Das helle Licht der Leuchtstoffröhren blendet und der Lichtschalter klebt beim Ausschalten ein wenig. Da war wohl Kollege Bommel mit seinen Zuckergussfingern vorher dran. Der Tee der Kollegin links riecht mal wieder vage nach Makrele und zwei Kollegen unterhalten sich unablässig und ein wenig zu laut über ihr aktuelles Projekt, während das Telefon eines später kommenden Kollegen penetrant klingelt.
Es ist früh am Morgen, aber alle unsere Sinne befinden sich schon in voller Aktion - ob wir es wollen oder nicht.
Die klassischen fünf Sinne des Menschen:
- Sehen
- Hören
- Riechen
- Schmecken
- Tasten
Zusammen mit dem Sehsinn wird das Hörvermögen zu den Fernsinnen gezählt, die in unserem Alltag als wichtigste Informationsüberträger gelten.
Das menschliche Hörorgan (= Ohren, Hörnerven und auditive Hirnrinde) ist, wie die meisten Funktionseinheiten des menschlichen Körpers bei genauerer Betrachtung, ein kleines Wunderwerk. Es hört Frequenzen zwischen 16 und 20.000 Hertz, hilft uns bei der Raumorientierung, beinhaltet das Gleichgewichtsorgan und steht 24 Stunden durchgehend auf Empfang.
Evolutiv gesehen ist dies durchaus sinnvoll. Würden sich die Ohren aus Erholungsgründen von Zeit zu Zeit einfach abschalten, wir wären schon längst alle von Säbelzahntigern vertilgt oder von modernen Kleinlieferwagen niedergemäht worden. Hören zu können dient der Kommunikation, aber auch unserer Orientierung in der Welt.
Ab wann ist Lärm auch Lärm?
Geräusche gehören somit zu unserem täglichen Leben. Nehmen sie in Dauer und/oder Lautstärke jedoch überhand, sprechen wir von Lärm und fühlen uns gestört. Im unteren Dezibelbereich ist dies teilweise noch von Stimmung und individueller Wahrnehmung abhängig. Eine Studie* ergab sogar, dass tagsüber ein moderater Geräuschpegel um die 70 Dezibel die Kreativität besser ankurbelt als eine stillere Umgebung mit beispielsweise 50 Dezibel.
Übersteigt der Lärm aber die 85 Dezibel sind sich Studien und Ärzte einig: dieser Lärm macht krank.
Denn Lärm löst im Körper Stress aus, der schüttet entsprechend die stressgekoppelten Hormone aus, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt.
Besonders ein über längere Zeit bestehender hoher Lärmpegel ist schädlich und kann durch den oben beschriebenen Mechanismus sogar zu Herzinfarkten führen, selbst wenn wir die Geräuschkulisse – notgedrungen – schon gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Doch unser Körper reagiert trotzdem auf die lauten Signale. „Der Körper leidet auch nach vielen Jahren der Lärmbelästigung noch unbewusst darunter“, so Lärmforscher Michael Jäcker-Cüppers, der Leiter des Arbeitsrings „Lärm“ der Deutschen Gesellschaft für Akustik.
Welchem Lärm sind wir tagtäglich ausgesetzt und was sind seine Folgen?
Besonders störend werden Geräusche während der Nacht wahrgenommen, sowohl bewusst als auch unbewusst. Jeder kennt es: tagsüber kaum oder nicht wahrnehmbare Geräusche wie das Surren des Kühlschranks, das Knacken der Heizung oder das Ticken einer Uhr gewinnen in der Dunkelheit eine geradezu raumbeherrschende und gefühlt ohrenbetäubende Präsenz, während man sich im Bett herumwälzt und eigentlich nur gerne schlafen würde.
Auch eine qualitative Komponente scheint bei der Lärmwahrnehmung zu existieren; so wird Straßenverkehrslärm schon ab 65 Dezibel (dB) als störend oder gar quälend empfunden, während Meeresrauschen allgemein als angenehm gilt, obwohl es bis zu 100 dB erreichen kann. In der Theorie ist dies so, weil das Meeresrauschen rhythmisch ist und als eine Art langsamer Herzzschlag wahrgenommen wird.

Was kann man also daraus schließen? Lärm sollte, solange er vom Individuum nicht im Kontext als ausgesprochen positiv empfunden wird, vermieden werden. Doch wie setzt man diese Erkenntnis in die Praxis um? Schon eine stark befahrene Straße beschallt uns mit 70 bis 80 dB. Eine Autohupe, bei stark befahrenen Straßen kein unbedingt seltenes Ereignis, quäkt uns mit bis zu 100 dB zu. Der Rasenmäher des Nachbarn erreicht ebenfalls je nach Ausführung zirka 100 dB, ein Flugzeug kommt auf 120 bis 130 dB.
Zum Vergleich:
- schon Lärm über 100 dB kann ein akutes Lärmtrauma hervorrufen.
- ab ca. 125 Dezibel kann es zu einer akuten Hörschädigung kommen.
- Kurzzeitiger Lärm über 150 dB kann in einem Knalltrauma enden.
- Nur etwas länger anhaltender Lärm über 150 dB kann ein Explosionstrauma bewirken, das sich ohne Behandlung nur selten zurückbildet.
Sind die Haarzellen im Innenohr, die Schallwellen in elektrische Signale umwandeln und an das Gehirn weiterleiten, erst irreversibel geschädigt, ist es schon zu spät.
Lärm während der Arbeitszeit
Vollständig kann fast niemand Lärm entgehen. Aber Sie können Vorsichtsmaßnahmen treffen. Im Arbeitsumfeld ist dies sogar zwingend angeraten und vorgeschrieben, denn Lärm belastet kurz- und langfristig die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter. Gemäß der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung darf der gemittelte Lärmexpositionspegel während einer Arbeitszeit von 8 Stunden den Wert von 80 dB nicht überschreiten. Ist dies der Fall, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer einen passenden Gehörschutz zur Verfügung zu stellen.
Für jeden in entsprechenden Bereichen tätigen Arbeitgeber sollten präventive Maßnahmen demnach selbstverständlich sein. Dazu gehören beispielsweise Gebotsschilder, mit denen die Verwendung eines Gehörschutzes vorgeschrieben wird oder die Zurverfügungstellung von verschiedenen Gehörschutzmitteln.

Rechtsvorschriften
Bezüglich des Lärmschutzes gibt es diverse Pflichten und Empfehlungen aus den Bereichen
- Bundesrecht
- Europäische Richtlinien
- Internationale Übereinkommen
Eine erschöpfende Auflistung aller relevanten Regelungen finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
www.bmu.de/service/gesetze-verordnungen
Die Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat eine informative Seite bezüglich der Lärmrichtlinien am Arbeitsplatz zusammengestellt:
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physikalische-Faktoren-und-Arbeitsumgebung/Laerm/Vorschriften.html
Was können Sie persönlich tun?
- Legen Sie bewusst jeden Tag Lärmpausen ein. Bei einem Spaziergang in ruhiger Umgebung oder einer Auszeit mit einem guten Buch.
- Halten Sie Abstand von Lärmquellen. Niemand muss während einer Veranstaltung zwingend direkt vor den Lautsprechern stehen.
- Halten Sie für Lärmsituationen einen Gehörschutz parat.
- Schalten Sie das Radio oder den Fernseher einfach mal aus.
- Mieten Sie sich eine Stunde im „stillsten Ort der Welt“. ;-)
- Die Laboratories Anechoic Test Chamber aus Minneapolis (USA) schluckt 99,99% allen Schalls und steht damit im Guinness Buch der Rekorde. Länger als 45 Minuten hat es allerdings noch niemand in diesem Raum ausgehalten.
Welcher Gehörschutz passt zu mir?
Gehörschutzvorrichtungen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: kopfhörerartige Gehörschutzkapseln und Stöpsel, die direkt in den Gehörgang eingeführt werden.
Kapseln werden schwerpunktmäßig im professionellen Umfeld eingesetzt, sofern dies in Kombination mit der weiteren Schutzausrüstung möglich ist.
Stöpsel sind sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich weit verbreitet und hier gilt es, die passende Ausführung zu wählen.
- Klassische Ohrstöpsel aus Schaumstoff
- Stöpsel aus mit Wachs getränkter Watte
- Ohrstöpsel aus Gummi oder Kunststoff (Einweg und Mehrweg)
- Musikohrstöpsel (dämpfen Geräusche und lassen Musikfrequenzen nahezu ungehindert durch)
Otoplastiken

Quelle: © Firma V • Shutterstock.com
Abschließend sei gesagt: wie schon erwähnt ist unser Hörvermögen ein im Alltag sehr wichtiger Informationsübermittler. Der Verlust des Hörvermögens ist keine Kleinigkeit, da es nicht nur im beruflichen Umfeld Einschränkungen geben, sondern auch im Privatleben die Teilhabe am Alltag massiv eingeschränkt wird. Berufliche und soziale Isolation ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Nutzen Sie daher die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Gehörschutzausrüstung oder erinnern Sie Ihre Angestellten regelmäßig an deren Verwendung.
_ _ _ _ _
* “Is Noise Always Bad? Exploring the Effects of Ambient Noise on Creative Cognition”, Journal of Consumer Research